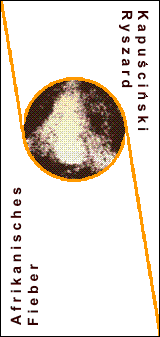|
Rezension:
→ Ryszard Kapuscinski - Afrikanisches
Fieber
Ein Ort, den es nicht gibt "Dieser Kontinent ist zu groß, als dass man ihn beschreiben könnte." Äußert sich ein Autor in der Vorbemerkung eines Buches mit dem Titel Afrikanisches Fieber solcherart, klingt das wie eine Provokation. Dabei stürzt sich Ryszard Kapuscinski nicht das erste Mal in eben diese Beschreibung. Zum Thema Afrika, das es, wie er sagt, in Wirklichkeit gar nicht gebe, hat der polnische Journalist und Schriftsteller schon mehrere Literarische Reportagen verfasst. Hier nun die Erfahrungen aus vierzig Jahren, wie der Untertitel lautet.
Vierzig Jahre Erfahrung, kein Zweifel, ein Eingeweihter. Von ihm lassen wir - die Leser - uns gern in diese Welt einführen, so wir sie noch nicht kennen oder überlassen ihm die Rolle des Lotsen für unsere Erinnerung, falls wir diesen Kontinent, dieses Afrika, das es gar nicht gibt, erneut er-fahren wollen. Und wie wir ihm folgen, hat uns - noch im Bemühen um Orientierung - der Sog seiner Erzählung ergriffen. Dabei macht es uns Kapuscinski nicht leicht: Eine Struktur im Gesamttext ist schwer erkennbar. Sowohl der zeitliche wie der räumliche Zusammenhang sind nur lose geknüpft. Zwar beginnt die Reise im Jahr 1958 in Ghana mit der Unabhängigkeit dieses Landes und endet gegen Ende des Jahrhunderts in Ostafrika, dazwischen aber liegen große räumliche und zeitliche Sprünge. Zudem unterbricht Kapuscinski seine Literarischen Reportagen durch Exkursionen in wissenschaftliche Dimensionen, wenn er z.B. von der Klanstruktur oder in seiner Vorlesung über Ruanda über die Hintergründe des länderübergreifenden Bürgerkriegs berichtet. Er verlässt das vertraute Terrain sozialrevolutionärer Ursachen und führt mit zunehmender Komplexität des Konflikts zwischen Hutu und Tutsi eine neue, schwer zu fassende psychologische Kategorie ein. Die Angst vor der Rache, sagt er, trage als wesentliches Moment zum Verständnis der Auseinandersetzung bei. Viele der von Kapuscinski verwendeten Bilder begeistern durch ihre Einfachheit, einige jedoch laufen Gefahr, jene unsichtbare Grenze zu überschreiten und oberflächlich zu wirken, wie zum Beispiel jenes der Madame Diuf. Unentwegt kommentiert diese das Vorgefallene - in erster Linie die Schnäppchen, die sie von fliegenden Händlern an den Stationen ergattert -, während sie sich breit macht im Abteil des Zuges von Dakar nach Bamako. Ryszard Kapuscinski konstatiert ohne erkennbare Gefühlswallung eine Veränderung: Ein solches Verhalten habe er während früherer Aufenthalte nicht erlebt, auf den Europäer, auf das Komfortbegehren des weißen Besuchers, würde keine Rücksicht mehr genommen. Oder der düster dreinblickende Elefant, der plötzlich aus dem Busch auftaucht und die Gesellschaft an den Tischen im Freien vor Schreck erstarren lässt. Als der Elefant ohne Schaden anzurichten, wieder verschwunden ist, fragt ein Tansanier Kapuscinski, ob er das gesehen habe. Kapuscinski antwortet: "Ja, ein Elefant." "Nein", sagt der. "Der Geist Afrikas nimmt immer die Gestalt eines Elefanten an. Weil kein Tier den Elefanten besiegen kann." Kapuscinski lockt mit schönen Namen, schönen Städten wie Lalibela, das er 1975 besuchte und schockiert uns, indem er die Existenz des äthiopischen Hungers nicht verschweigt. Und das Glück der Fischer über den fetten Fang, bereitet uns mehr als Unbehagen; es erreicht die Grenzen der Pietättoleranz, wenn der Autor die Herkunft der Beute enthüllt: Der ostafrikanische See, dem sie entrissen wurde, berge noch viele Opfer des herrschenden Bürgerkriegs. Eine kleine, unerwartet eingestreute Information genügt, uns zu schockieren und unsere Aufmerksamkeit erneut zu schärfen. Das Unerwartete setzt Ryszard Kapuscinski oft und zielsicher ein. Damit hält er die Sinne des Lesers wach. Obschon er an keiner Stelle des Buchs Gefahr läuft, sich der Beschreibung einer Idylle hinzugeben, wechselt er spontan den literarischen Ton, wird lakonisch oder schlägt den sachlichen Ton einer journalistischen Reportage an. Schon im Ansatz zerstört er Sequenzen, die dem Leser suggerieren könnten, sich an einem schönen Ort zu befinden. Nein, Afrika ist kein schöner Ort. Es gibt ihn gar nicht. Es gibt ihn zumindest nicht so, wie die Jahre des Aufbruchs in den 60ern, als sich viele Länder aus der Umklammerung des Kolonialismus befreiten, es versprachen. Und trotzdem möchte man da sein, an der Seite dieses einzigartigen Chronisten, der mit dem in 40 Jahren gesammelten Material jongliert wie einer, der es meisterhaft versteht, aus der Fülle des Stoffs zu wählen und der weiß, wo das Ganze nicht fassbar ist, müssen die einzelnen Teile um so mehr glänzen. Die Faszination dieser Kunst entschädigt für manche Stelle, an der wir kleingeistig Kontinuität und Detailinformation begehren. Die Präsenz des Chronisten tritt nur selten in den Vordergrund, und nie ist es die heldenhafte Pose, die sich vom klar bezeichneten Hintergrund abhebt, eher die des Leidens, jedoch ohne jegliche Larmoyanz, im Gegenteil: Im Innern des Eisbergs, wenn ihn das Fieber der Malaria packe, fühle er sich wohl, sagt Kapuscinski. Es ist schwer, das Afrikanische Fieber nicht zu lieben.
4/2003
© by Janko Kozmus |
|||||||||||||||||
| Lesen Sie auch die Rezension zu den Reportagen des Afrika-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung: Michael
Bitala: Afrikas verlorene Menschen
(zu: Hundert Jahre Finsternis ...) |
|